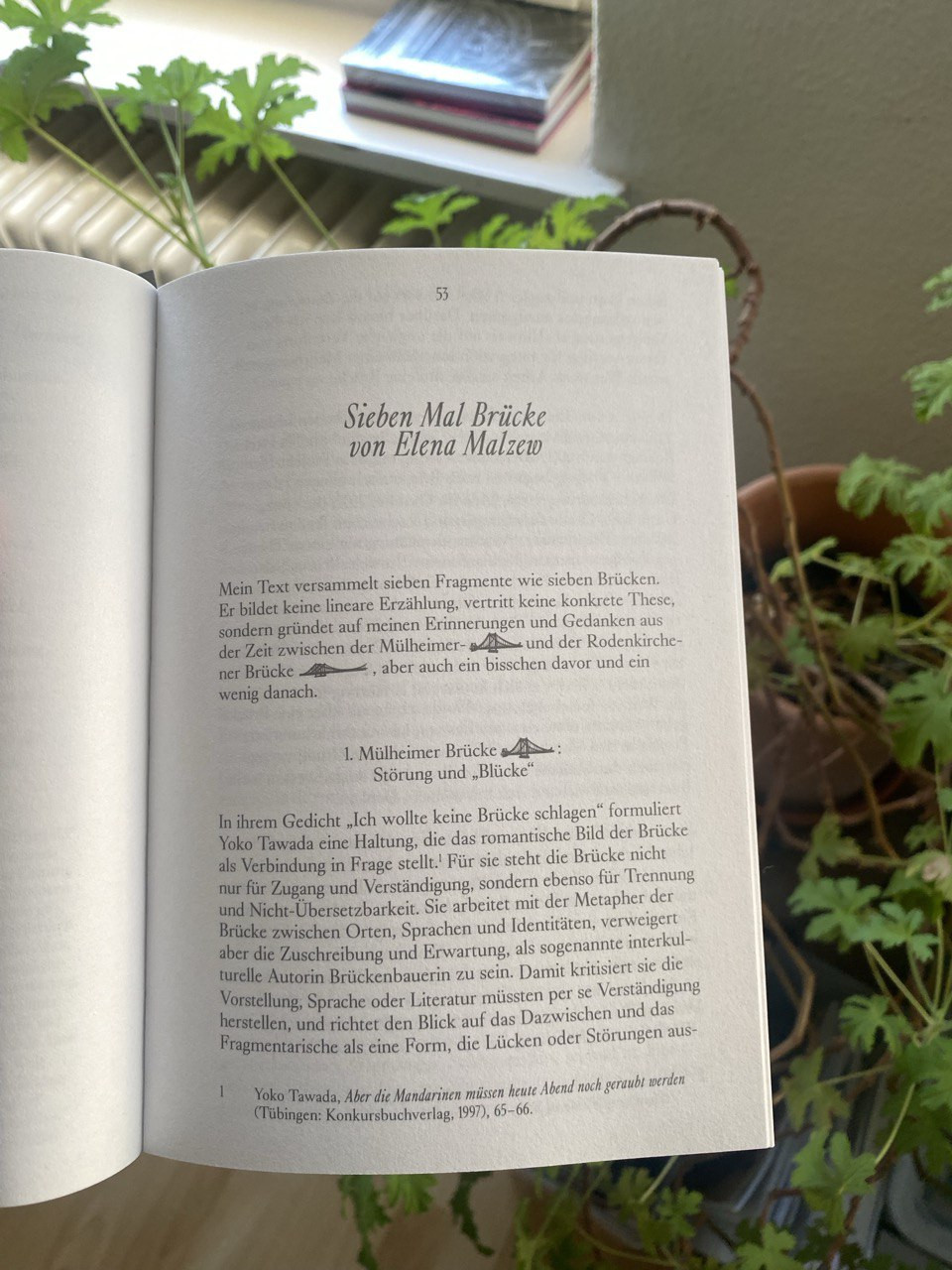Sieben Mal Brücke
Mein Text versammelt sieben Fragmente wie sieben Brücken. Er bildet keine lineare Erzählung, vertritt keine konkrete These, sondern gründet auf meinen Erinnerungen und Gedanken aus der Zeit zwischen der Mülheimer- und der Rodenkirchener Brücke, aber auch ein bisschen davor und ein wenig danach.
1. Mülheimer Brücke: Störung und „Blücke“
In ihrem Gedicht „Ich wollte keine Brücke schlagen“ formuliert Yoko Tawada eine Haltung, die das romantische Bild der Brücke als Verbindung in Frage stellt. Für sie steht die Brücke nicht nur für Zugang und Verständigung, sondern ebenso für Trennung und Nicht-Übersetzbarkeit. Sie arbeitet mit der Metapher der Brücke zwischen Orten, Sprachen und Identitäten, verweigert aber die Zuschreibung und Erwartung, als sogenannte interkulturelle Autorin Brückenbauerin zu sein. Damit kritisiert sie die Vorstellung, Sprache oder Literatur müssten per se Verständigung herstellen, und richtet den Blick auf das Dazwischen und das Fragmentarische als eine Form, die Lücken oder Störungen aushalten kann und zugleich eine Antwort auf die Zumutung ist, sich reibungslos anzupassen. Darüber hinaus lese ich diese Verweigerung als Hinweis auf die ungleiche Verteilung von Verantwortung für Integration innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft: Wer muss Arbeit leisten, um eine Brücke zu bauen?
Den Text von Tawada fand ich auf mehreren Ebenen bedeutsam. Zum einen, recht banal, weil das Wort „Brücke“ im Titel steht. Bedingt durch die Auseinandersetzung mit dem Projekt Über Brücken – Bridging begleiten mich Brücken seit einigen Jahren. Die Veranstaltungen starteten im Oktober 2022, die ersten Gespräche, Ortsbesichtigungen und Recherchen fanden bereits 2021 statt. Die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema sensibilisierte meinen Blick auf meine Umwelt. Wie es Sales Rödel und Martin Karcher in der Einführung des Sammelbandes Lebendige Theorie beschreiben, führen solche Auseinandersetzungen zu Verschiebungen in Fremd-, Welt- und Selbstbeobachtungen. Eine längere und vertiefte Beschäftigung verändert unser Verhältnis zur (Um-)Welt; je länger wir uns mit einem Gegenstand befassen, desto mehr schreibt er sich in uns ein: Erfahrung formt nicht nur die Welt, sie formt auch uns. Werde ich jemals über eine Brücke gehen können, ohne dass mir das von Lisa und mir kuratierte Projekt in den Sinn kommt? Genau aus diesem Grund sprang mir auch das Gedicht von Yoko Tawada ins Auge, weckte mein Interesse und verband sich mit meinem Denken.
Zum anderen interessiert mich Tawadas Umgang mit Sprache. Ich schreibe diesen Text nicht in meiner Muttersprache, und er wird auch nicht in meine Muttersprache übersetzt. Sprechen und Schreiben auf Deutsch enthalten für mich Momente von Entfremdung und Unterbrechung; dies zeigt sich auch in „Ich wollte keine Brücke schlagen“, in Tawadas Kritik an der Vorstellung einer eindeutigen Zugehörigkeit durch Sprache. Um das Lückenhafte und die Unterbrechung zu betonen, die nur über Umwege Verbindungen ermöglichen, prägt sie den Neologismus „Blücke“ – eine Mischung aus „Brücke“ und „Lücke“.
2.Zoobrücke: Zickzack
Jede neue Brückenbegehung war ein Wechselspiel der Ufer. Die erste Begehung begann am Wiener Platz rechtsrheinisch der Mülheimer Brücke und endete an der Riehler Aue auf der linken Seite. Ein halbes Jahr später betraten wir die Zoobrücke links- und verließen sie rechtsrheinisch. Diese Bewegung setzten wir von Brücke zu Brücke fort, bis wir schließlich die Rodenkirchener Brücke erreichten. Das Ergebnis ist eine Zickzack-Linie über den Rhein, eine Bewegung, die zugleich Motiv und Denkweise markiert.
Zigzagging ist ein Begriff der feministischen Philosophin Rosi Braidotti, der Denk- und Erkenntnisprozesse beschreibt, die sich verschlungen und zickzackförmig, über Umwege und Widersprüche hinweg bewegen. Braidotti hinterfragt damit Vorstellungen einer linearen, (westlich) geprägten Auffassung von Zeit, Fortschritt, Erkenntnis und Entwicklung, ein Denken in Zielgerichtetheit und eindeutigen Kausalitäten. Demgegenüber betont sie komplexe Geflechte aus Erfahrungen, Kontexten und Bedeutungen, die sich verschachtelt entfalten: in Überlagerungen und Schichtungen.
Unser Projekt folgte genau diesem Prinzip. Bei der Einladung der Künstler*innen ging es uns nicht darum, eindeutige Zusammenhänge herzustellen, sondern ein Gefüge aus Geschichten aufzuspannen, auf die wir bei unserer gemeinsamen Recherche stießen: gesellschaftliche, kulturgeschichtliche und sozioökonomische Kontexte der Brücken, Verbindungen zu Migration, Stadtgeschichte und ihre Leerstellen, der öffentliche Raum und seine fortschreitende Privatisierung – um nur einige thematische Stränge zu nennen. Brücken sind also nicht nur Verbindungen von Ufern, sie sind materielle Ausdrücke gesellschaftlicher Ordnungen, Schnittstellen, an und in denen sich unterschiedliche Diskurse überlagern und somit Orte multiperspektivischer und zickzackförmiger Erzählungen.
3. Hohenzollernbrücke: Irtysch
Ich bin in Omsk aufgewachsen, einer Stadt am Irtysch, einem der größten Flüsse Sibiriens und Russlands. Sein Verlauf hat nicht nur die Stadtentwicklung, sondern auch die Geschichte meiner Familie nachhaltig geprägt. Wir lebten am rechten Ufer, dort, wo Omsk heute dichter und urbaner ist, während das linke lange weniger erschlossen blieb – ein Umstand, der auf die frühere Stadtentwicklung seit der Gründung im Jahr 1716 zurückgeht. Einst verband nur die Leningrader Brücke die beiden Ufer; heute spannt sich ein ganzes Netz von Brücken über den Fluss. Als ich in den vergangenen Jahren häufiger in Köln für unser Brücken-Projekt war und viele Stunden am Rhein verbrachte, dachte ich oft an den Irtysch. Ich erinnerte mich an meine Kindheit und an die Fotoalben meiner Familie mit den Bildern von den Schiffen und dachte darüber nach, was die Flüsse Rhein und Irtysch gemeinsam haben und was sie unterscheidet.
Mein Vater kam in den 1970er Jahren nach Omsk, um eine Karriere in der Schifffahrt aufzubauen. Nach dem Wehrdienst bei der Marine studierte er Schiffsingenieurwesen und arbeitete sich Schritt für Schritt zum Kapitän hoch. Etwa die Hälfte jedes Jahres war er auf verschiedenen Schiffen auf Navigationsfahrten unterwegs, den Irtysch und den Ob hinauf bis in den Norden. In den Herbst- und Wintermonaten, wenn die Flüsse zufroren, blieb er in der Stadt und arbeitete im Betrieb als Schiffsingenieur. In den ersten Jahren nach meiner Geburt fanden meine Eltern lange keine Wohnung und so lebten meine Mutter und ich mehrere Monate an Bord von jenen Schiffen, auf denen mein Vater arbeitete. Meine Mutter half zeitweise als Matrosin, und meinen zweiten Geburtstag feierten wir auf einem Schiff, auf der Höhe von Neftejugansk – einer Erdölstadt in Westsibirien. Irgendwann bekamen meine Eltern ein Zimmer im Wohnheim der Omsker Schiffswerft, einem Haus, in dem Beschäftigte aus unterschiedlichen Berufen rund um die Schiffahrt und den Irtysch mit ihren Familien lebten. Sowohl dieses Wohnheim als auch unsere spätere Wohnung im Stadtzentrum lagen am rechten Ufer des Irtysch. Ich war fünf Jahre alt, als ich zum ersten Mal am linken Flussufer war. Dort sah man damals vor allem Baustellen und eine Landschaft aus Hochhäusern, die typischen „Spalnyj Rayon“, die Schlafbezirke der Stadt, die seit den 1980er-Jahren in allen großen russischen Städten boomten. Nach einem kurzen Aushilfseinsatz auf dem Schiff meines Vaters blieb die Laufbahn meiner Mutter in gewisser Weise mit dem Irtysch verbunden. Sie arbeitete zwar nicht mehr an Bord, aber an der Omsker Universität für Wassertransport, wo sie angehenden Schiffsingenieur*innen Deutsch unterrichtete.
Wie man sich vorstellen kann, war meine Kindheit eng mit dem Fluss und der Schifffahrt verbunden. Es lag daher nahe, dass ich nach meinem Abitur dieselbe Universität für Wassertransport für das Studium wählte, an der auch mein Vater früher studiert hatte und an der meine Mutter lehrte, um dort Wirtschaft und Mathematik mit Schwerpunkt Schifffahrt zu studieren. Dort lernte ich vor unserer Migration nach Deutschland unter anderem, was eine Plimsoll‑Marke ist und wie tief ein Schiff je nach Wasserart und Jahreszeit maximal beladen werden darf.
Am Ende führte mein Weg fort vom Irtysch. An diesem Punkt denke ich erneut an Rhein und Irtysch. Beide trennen und verbinden. An Flüssen liegen Häfen und Brücken, dort beginnen Reisen. Diese Bewegungen schreiben Migration in die Orte ein und prägen Erinnerungen.
4. Deutzer Brücke: Das Herz ist Brücke Deine Beine sind Brücke Deine Hände Dein Blick Deine Worte: Brücke Brücke Brücke Brücke
„Es gibt keinen einzigen Ort“ – sagt Nouria Behloul in ihrer eindringlichen Arbeit. Sie erzählt vom Weggehen, von Mehrfachzugehörigkeiten und geteilten Geschichten und davon, dass wir, die weggegangen sind, ein Leben lang eine Brücke in uns tragen.
5. Severinsbrücke: Wurzeln
„Wuchs durch Beton, meine Wurzeln sind magic, ah […] Wir bleiben da, Wurzeln tief wie die Bäume, tief wie die Bäume“ – klingt aus meinen Airpods, als ich einmal im Kreis um die Severinsbrücke fahre und verzweifelt versuche, den richtigen Weg auf die Brücke zu finden. Wie oft, besonders am Anfang unseres Projekts, habe ich mich beim Besuch der einen oder anderen Brücke mit dem Fahrrad verfahren. In Köln bedeutet das meistens: Man landet auf der falschen Rheinseite und muss über die nächstgelegene Brücke zurück. Meine generell schlechte Orientierung, aber auch die Vielzahl an Unterführungen und Tunnels, die das Auffahren auf manche Brücken erschweren, machten es nicht leichter. Oft dauerte es ewig, und erst gegen Ende des Projekts wurde dieses Herumirren rund um die Brücken besser – viel Strecken zurückzulegen gehörte dazu.
Aber zurück zum Anfang: Ebow rappt hier über ihre kurdisch-alevitische Herkunft, über Entwurzelung und Zugehörigkeit, durchzogen von Schmerz, Migration, Widerstand und zugleich über eine Kraft, die daraus erwächst. Ich weiß nicht, ob es der weite Blick von der Severinsbrücke war, auf der ich nun nach etlichen Schleifen endlich angekommen war, oder die Musik – aber ich wurde sehr emotional, als ich oben auf der Brücke stand und an die Wurzeln dachte, über die Ebow singt.
6. Südbrücke: Nachleben
Der öffentliche Raum ist ein historisch gewachsener Gedächtnisraum und ein Archiv von Geschichten. Zugleich ist er ein Ort von ungleicher Sichtbarkeit. Nicht alle Spuren sind unmittelbar les- und sichtbar oder werden gleichermaßen erinnert: von Kolonialgeschichte, die bis heute in Straßennamen und Denkmälern eingeschrieben ist, über die Orte der NS-Zwangsarbeit, deren Lager und Arbeitsstätten oft verschwunden oder überbaut wurden, bis zu den jüngsten traumatischen Spuren rechter Gewalt im Stadtraum, den NSU-Anschlägen 2001 in der Kölner Probsteigasse und 2024 in der Keupstraße. Nach jahrelangen erfolglosen Ermittlungen und dem Versagen der Sicherheitsbehörden erwirkten zivilgesellschaftliche Gruppen und von Betroffenen gegründete Initiativen die Einrichtung eines Gedenkortes in der Nähe der Anschlagsorte. Das Mahnmal, das im Rahmen dessen an der Keupstraße errichtet werden sollte, wurde bis heute nicht realisiert. Dies zeigt, dass Erinnerungen umkämpft sind und bleiben. „Der Kampf um das Mahnmal ist bereits das Mahnmal“, heißt es auf der Website der Initiative ‚Das Mahnmal an der Keupstraße‘.
Der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Aby Warburg formulierte den Begriff des Nachlebens, um die Wiederkehr antiker Bilder und Symbole in späteren Zeiten und ihr Weiterwirken in neuen Kontexten zu beschreiben. Ihre emotionale Intensität, die Warburg als Pathosformeln bezeichnete, überdauert die Zeiten und wirkt weiter, sie prägt die Gegenwart als Teil des kulturellen Gedächtnisses und verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Das nicht gebaute Mahnmal bildet in diesem Sinne eine Leerstelle, die nicht nur die umkämpfte Erinnerung im Jetzt zeigt, sondern auch zukünftig nachwirken wird. Geschichtsschreibung ist ein Aushandlungsprozess, nicht nur fertige Monumente, sondern auch das Nicht-Erzählte, die Leerstellen, das Verdrängte, die marginalisierten Stimmen und unterdrückte Geschichten bestimmen unsere Zukunft. Vor diesem Hintergrund wird der Satz „Der Kampf um das Mahnmal ist bereits das Mahnmal“ zu einer prägnanten Formel für eine Erinnerungspraxis, die nicht im fertigen Objekt, sondern im Ringen selbst Gestalt annimmt und so schon heute die Formen des Gedenkens von morgen prägt. Ohne bewusste Korrektur werden diese Muster fortgeschrieben.
7. Rodenkirchener Brücke: Nach der Brücke ist vor der Brücke
Mit dem Bespielen der Rodenkirchener Brücke am 8. September 2024, vor gut einem Jahr, ging unser Projekt zu Ende. Keine Rheinbrücke in Köln ist übrig, doch Über Brücken – Bridging lebt weiter in Form dieser Publikation und vieler Erinnerungen. Als ich neulich zur Ausstellung von Mark Leckey in Berlin eilte, musste ich erneut daran denken, wie wir seine Arbeit Under Under In, 2019/2021 bei der Zoobrücke gezeigt haben und was für eine lange und letztendlich doch gut endende Odyssee es war.
Die auf sechs Monitoren synchron laufende Videoinstallation sollte zum ersten Mal im öffentlichen Raum gezeigt werden. Dafür flogen wir extra aus London einen Mitarbeiter ein, der die technische Betreuung übernehmen sollte. Trotzdem gab es unerwartete technische Schwierigkeiten mit der Folge, dass zwei Stunden vor der Eröffnung alle sechs Monitore schwarz blieben. Nach zahllosen Anläufen, etlichen Telefonaten mit befreundeten Techniker*innen und einer verbissenen Jagd nach extra langen HDMI-Kabeln durch Köln und das Umland an einem Samstag brachte am Ende Max Schmidt, der eigentlich nur für die Aufsicht der Arbeit vorgesehen war, die Installation wenige Minuten vor der Eröffnung zum Laufen. Die verhexte Geschichte ging weiter, als wir ein paar Tage später erfahren haben, dass die Fotodokumentation der Arbeit verloren wurde, sodass der Fotograf zusammen mit einem 3D-Designer die Dokumentation simulieren mussten. Die Bilder auf unserer Website und Instagram zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit.
All das ging mir durch den Kopf, als ich vor zwei Wochen zur Ausstellung von Mark Leckey die Leipziger Straße entlangfuhr.
Am Abend nach der Eröffnung habe ich einen Clip der Arbeit von Leckey auf Instagram gepostet, die letzten Minuten der Videoinstallation: Mehrere Jugendliche posieren in der Dunkelheit in Brückenposen, dazu laute Musik. Es fügte sich in die geladene Stimmung unter der Zoobrücke, mitten in der Nacht, in das Abklingen der Aufregung, während sich ein Sturm ankündigte und Gewitterblitze den Himmel durchzogen. Unter dem Post schrieb ich: „Nach der Brücke ist vor der Brücke.“