Anlässlich der Gastprofessur von Sung Tieu an der HFBK Hamburg im Wintersemester 2024/25
Elena Malzew, Architekturen des Sozialen
Lerchenfeld Nr. 72Hochschule für bildende Künste Hamburg2024
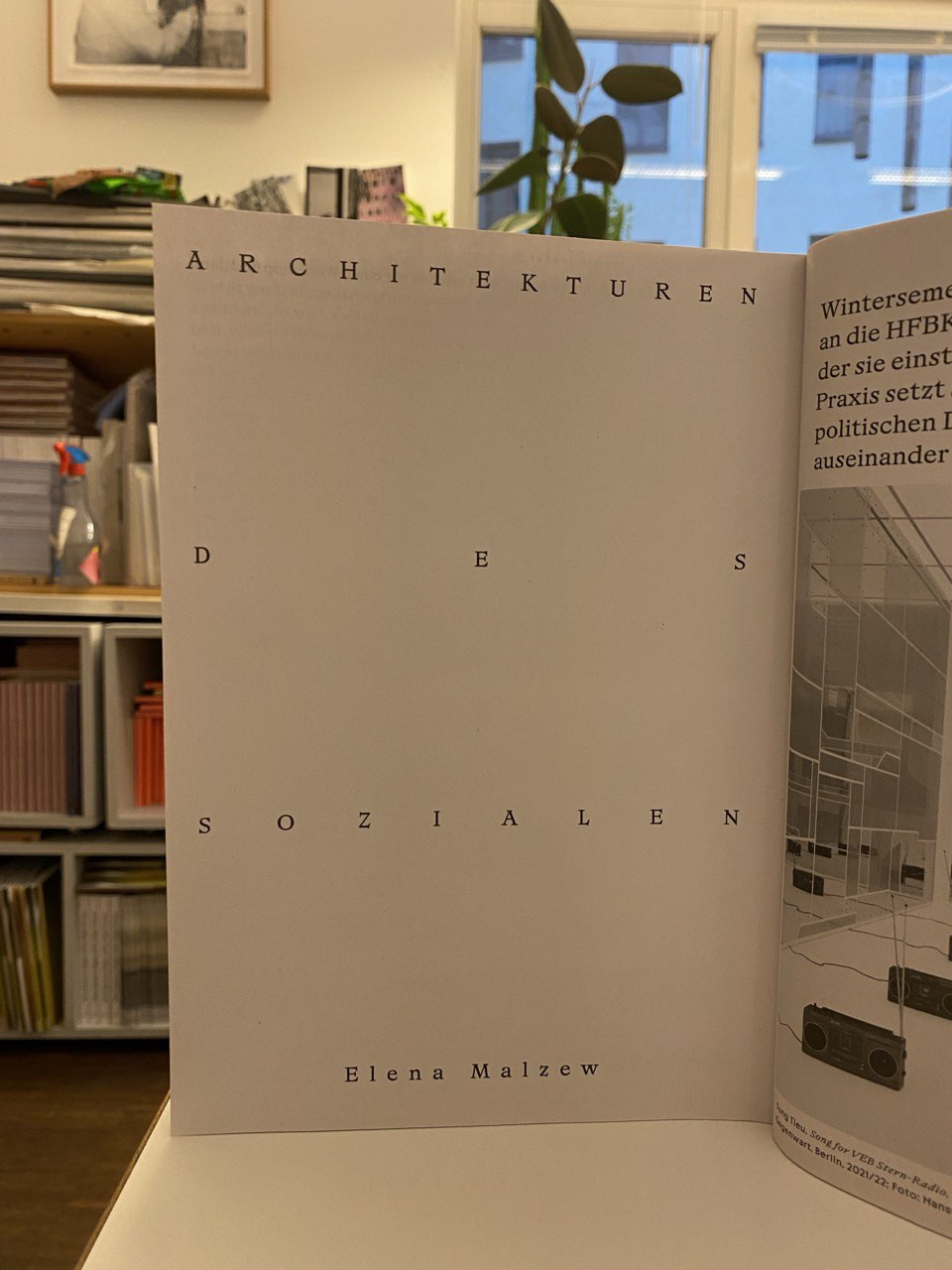
Elena Malzew
Architekturen des Sozialen
In ihrer forschungsbasierten, künstlerischen Praxis widmet sich die HFBK-Absolventin Sung Tieu (sie studierte von 2009 bis 2013 bei Prof. Andreas Slominski und am Goldsmiths College, London, bevor sie an die Royal Academy of Arts, London, wechselte) historischen und politischen Themen, deren Genese und Verstrickungen bis hinein in die Gegenwart reichen. Sie richtet ihren Blick auf das hegemonial Unerzählte, auf mehrheitsgesellschaftlich wenig beachtete Zusammenhänge und beschäftigt sich insbesondere mit den Verschränkungen von Gesellschaft und Individuum, ferner den Zusammenhängen von Architektur und Bürokratie und Infrastrukturen der Macht sowie den psychischen und sozialen Folgen politischer Apparate. Dabei greift sie auf Archivdokumente, historische Texte, Tonaufnahmen und andere dokumentarische Materialien zurück und verwebt diese mit biografischen Elementen oder aktuellen Ereignissen zu vielschichtigen narrativen Installationen. Die daraus resultierenden, meist minimalistischen Umgebungen und Arbeiten, vereinen Medien wie Skulptur, Video, Fotografie, Zeichnung, Text und Sound. Ihre prozesshafte Arbeiten und die intensive Beschäftigung mit den aufgerufenen Themen findet oft über mehrere Ausstellungen und Projekte hinweg statt.
Ein zentrales Thema in Tieus Arbeit ist die Auseinandersetzung mit ihrer Migrationsgeschichte nach der Wendezeit. Besonders viel öffentliche Resonanz erfuhr ihr jüngstes Projekt, in dem sie Führungen durch den ehemaligen größten Wohnkomplex für vietnamesische Vertragsarbeiterinnen der DDR in der Berliner Gehrenseestraße anbot – ein Ort, an dem sie von 1994 bis 1997 mit ihrer Mutter lebte. Die Hochhaussiedlung, inzwischen zu einer unbelebten Ruine geworden und kurz vor dem Abriss stehend, war das Zuhause von Tausenden Vertragsarbeiterinnen, die im Rahmen bilateraler Abkommen zwischen der DDR und der Sozialistischen Republik Vietnam in den 1980er Jahren in die DDR kamen. Diese Plattenbausiedlung, bestehend aus etwa 1.000 Wohnungen, wurde ab 1977 als staatliches Wohnprojekt geplant und in den 1980er-Jahren für die DDR-Vertragsarbeiterinnen genutzt. Es handelt sich um ein wenig beachtetes Kapitel deutscher Geschichte, das doppelt in Vergessenheit zu geraten scheint: Zum einen aufgrund der geringen und verzerrten Aufmerksamkeit, die der Geschichte der DDR aus der hegemonialen Perspektive der BRD zuteil wird, und zum anderen, weil die Geschichte der vietnamesischen Arbeitsmigrantinnen selten im Fokus der historischen Aufarbeitung steht. Sung Tieu verknüpfte in ihren Führungen persönliche Kindheitserinnerungen mit politischen und historischen Fakten, um auf den bevorstehenden Abriss des Wohnkomplexes aufmerksam zu machen, durch welchen ein wichtiger Teil des kollektiven Gedächtnisses und Erbes der vietnamesischen Community verloren zu drohen geht. In sorgfältig erzählten Führungen schildert sie die beengten Wohnsituationen und überwachten Lebensverhältnisse in der Gehrenseestraße, wo Berufs- und Privatleben der Vertragsarbeiterinnen durch strenge Hausordnungen und bürokratische Reglementierungen fremdbestimmt und Kontakte zur lokalen Bevölkerung eingeschränkt wurden. Tieu thematisiert die rassistischen Diskriminierungen, denen die Vertragsarbeiterinnen ab den späten 1980er und frühen 1990er Jahren in der DDR ausgesetzt waren, sowie die prekären Lebensbedingungen nach der Wende, als Arbeitsverträge gekündigt wurden und den Arbeiter*innen ein unsicherer Aufenthaltsstatus drohte. Für ihre Recherchen erhielt Tieu den Preis für Künstlerische Forschung der Schering Stiftung im Jahr 2024 erhielt.
In der Ausstellung Song For VEB Stern-Radio im Hamburger Bahnhof 2021 setzt sich Tieu mit der Geschichte des VEB Stern-Radios auseinander, einer ehemaligen Radiofabrik der DDR, und deren politischen sowie kulturellen Implikationen. Die Radios, die mit Hilfe von vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen produziert wurden und als Symbole für die Verbreitung und Regulierung von Informationen in der DDR dienten, werden in der Ausstellung nicht nur als funktionale Objekte, sondern als Träger von Ideologien und Massenkultur präsentiert. Durch die Kombination von historischen Radioaufnahmen, Dokumenten, architektonischen Fragmenten und akustischen Elementen schafft Tieu komplexe Erzählungen über die politischen und sozialen Aspekte der DDR und deren Auswirkungen auf die vietnamesische Gemeinschaft hinzuweisen, insbesondere im Hinblick auf Migration und Arbeitsbedingungen.
Indem Tieu in ihren Ausstellungen architektonische Eingriffe, mit recherchiertem Material, Readymades, Bildern und Sounds aus verschiedenen Quellen – von Familien- und Archivmaterial bis hin zu neu produzierten, gefilmten und aufgenommenen Aufnahmen – verdichtet, setzt sie historische Kontexte und persönliche Erinnerungen in Beziehung zueinander. Sie schafft Verbindungen zwischen individuellen und kollektiven Erfahrungen und legt dabei historische Kontinuitäten offen, die in ihren eindringlichen Installationen erfahrbar werden. Dabei spielt Sound eine prägende Rolle, der ihre Skulpturen und Ausstellungen bewohnt und neue Räume entstehen lässt, nicht zuletzt durch den gleichzeitigen Einsatz von mehreren raumfüllenden Soundquellen.
Neben dem bildhauerischen Aspekt des Sounds interessiert sich Tieu auch für dessen politische und psychologische Dimensionen. Ein Beispiel hierfür ist ihre Abschlussarbeit an der Royal Academy of Arts, Song for Unattended Items (2018), eine immersive 11-Kanal-Soundinstallation, die das Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörung untersucht. Die Installation besteht aus elf unbeaufsichtigten Taschen, die im Raum verteilt sind und mit verschiedenen Sounds wie Kaminfeuer, Flugzeugen, Vogelgezwitscher und Feuerwerk ausgestattet sind. Obwohl diese Klänge einzeln harmlos erscheinen, erzeugen sie im Zusammenspiel eine bedrohliche Atmosphäre und suggerieren eine Gefahrenzone. Die Arbeit basiert auf einem Bild aus der Zeit des Vietnamkriegs, das einen US-amerikanischen Soldaten zeigt, der einen Rucksack mit Lautsprechern trägt. Die Lautsprecher spielen das sogenannte „Ghost Tape No.10“ ab – eine von den US-Streitkräften entwickelte psychologische Waffe, die darauf abzielte, das Verhalten und die Denkweise des auserkorenen Gegners durch gezielte akustische Manipulation zu beeinflussen. „Ghost Tape No.10“ ist eine etwa vierminütige Tonaufnahme, in der ein Schauspieler die Rolle eines gefallenen nordvietnamesischen Soldaten einnimmt, der verzweifelt nach seiner Familie ruft und seine Kameraden ruft und die auffordert, den Krieg zu beenden. Die von der PSYOPS (Psychological Operations of the US Army) entwickelte akustische Kriegsführung zielte darauf ab, die spirituellen Überzeugungen der Vietnames*innen zu manipulieren, die daran glaubten, dass unbestattete Seelen als ruhelose Geister auf der Erde verweilen. Diese gewaltvollen, psychologischen Effekte von Klang untersucht Tieu fortlaufend in ihrer Arbeit. In No Gods No Masters (2017) setzt sie ihre Auseinandersetzung mit ‘Ghost Tape No.10’ fort, indem sie diesen Klang mit elektronischen Sounds, Field Recordings und dokumentarischen Aufnahmen vom ehemaligen Schauplatz des ‘Ghost Tape No. 10’ sowie aus privaten, familiären Zusammenkünften in Vietnam kombiniert. . Durch die Verknüpfung dieser vielschichtigen Klang- und Bildmaterialien erschließt Tieu nicht nur verschiedene zeitliche Ebenen, sondern dekonstruiert die politische Dimension von Klang, indem sie dessen manipulative Kraft offenlegt.